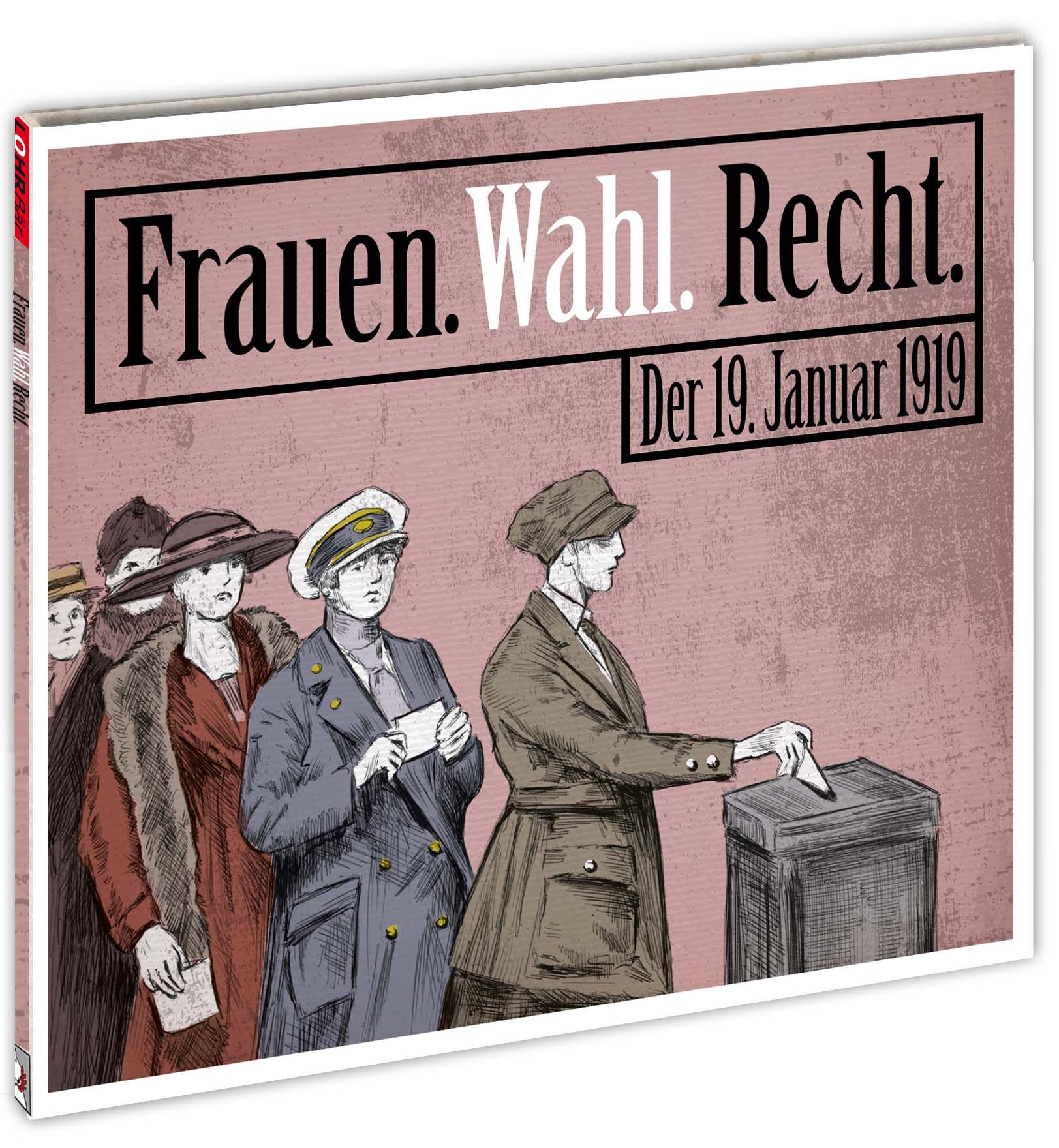
Angela Kreuz / Dieter Lohr (Hrsg.)
Frauen. Wahl. Recht.
Lesungen mit Texten von Fanny Lewald, Hedwig Dohm, Helene Lange, Constanze Hallgarten, Minna Cauer, Marianne Weber, Ina Seidel, Thomas Mann, Viktor Klemperer u.a.
Gelesen von Gunna Wendt, Eva Demski, Monika Manz, Eva Sixt, Kira Bohn, Christin Alexandrow, Michael Haake, Martin Hofer, Matthias Winter u.a.
Musik: Gabriele Wahlbrink
1 Audio-CD, 78 Minuten, 14,90 €
ISBN 978-3-939529-18-7
Hörprobe 1
Hörprobe 2
Hörprobe 3
Der 19. Januar 1919 stellt für die deutsche Geschichte und die Frauenbewegung ein zentrales Datum dar, das die Geschichtsschreibung indes beiläufig nennt, aber nicht weiter ausführt. Die Ereignisse im zeitlichen Umfeld dieses in jeder Hinsicht milden Wintertages waren weitaus dramatischer und erinnerungsträchtiger: Vier Tage zuvor waren Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordet worden, einen Monat später starb Kurt Eisner bei einem Attentat. Der Alltag in den Monaten nach dem ersten Weltkrieg war geprägt durch extreme wirtschaftliche Not, Streiks, Straßenschlachten, nächtliche Plünderungen, Schießereien und politische Morde.
Der 19. Januar 1919 dagegen blieb erstaunlich ruhig. An diesem Tag wurde zur ersten Nationalversammlung der Weimarer Republik gewählt. Und erstmals waren auch Frauen wahlberechtigt.
Angela Kreuz und Dieter Lohr spüren diesem Datum nach, das die ersehnte Erfüllung des Kampfes eines halben Jahrhunderts darstellte. Wie kam es zu dieser Wahl, wie sahen die zwei Monate zwischen dem Ende des ersten Weltkriegs und dieser Wahl aus, wie gestaltete sich der Wahlkampf, wie der Wahltag selbst, welche Hoffnungen und Ängste verbanden sich damit?
Texte von Fanny Lewald, Hedwig Dohm, Helene Lange, Constanze Hallgarten, Ina Seidel, Marianne Weber, Minna Cauer, Lida Gustava Heymann, Harry Graf Kessler, Gertrud Bäumer, Thomas Mann, Victor Klemperer, Käthe Kollwitz, Oskar Münster-berg, Ludwig Langemann, Marie Bernays und Marie Juchacz.
Gelesen von Gunna Wendt, Monika Manz, Eva Demski, Eva Sixt, Angelika Wende, Kira Bohn, Heike Ternes, Christin Alexandrow, Matthias Winter, Martin Hofer, Eva Ambrosius, Michael Haake, Bettina Schönenberg, Sofia Mindel, Kai Raecke, Ole Bosse und Doris Dubiel.
Das Frauenwahlrecht in Deutschland
Beginnend in Italien, Spanien und Frankreich kam es Anfang und Frühjahr 1848 europaweit zu Aufständen gegen die seit dem Ende der Napoleonischen Kriege herrschenden Mächte der Restauration, die nach Kräften daran arbeiteten, die politischen Zustände vor der Französischen Revolution wiederherzustellen. Im März wurden auch die deutschen Länder von dieser Bewegung erfasst. Die Revolutionäre erzwangen die Berufung liberaler Regierungen in den Einzelstaaten des Deutschen Bundes und die Durchführung von Wahlen zu einer verfassungsgebenden Nationalversammlung. Diese trat erstmals am 18. Mai 1848 in der Frankfurter Paulskirche zusammen, und wenngleich die Verfassung, die sie entwarf, von den maßgeblichen deutschen Fürsten nicht anerkannt wurde, hatte der enthaltene Grundrechtskatalog für die Weimarer Verfassung und selbst noch das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland Modellcharakter. Kernelemente waren die Gleichheit aller vor dem Gesetz, die Gewährleistung persönlicher und politischer Freiheitsrechte (Presse-, Meinungs-, Versammlungs-, Gewerbefreiheit etc.) sowie die Abschaffung der Todesstrafe. Eine weitere Errungenschaft der Frankfurter Nationalversammlung war ein Wahlgesetz für allgemeine und gleiche Wahlen, das sich an das Bundeswahlgesetz vom März/April 1848 anlehnte, nach dem die Nationalversammlung selbst gewählt worden war.
Hier hieß es: „Wähler ist jeder unbescholtene Deutsche, welcher das fünfundzwanzigste Lebensjahr zurückgelegt hat.“ Die Formulierung „jeder Deutsche“ (unbescholten oder nicht) mag für heutige Ohren unpräzise und missverständlich klingen. Sie ist es aber durchaus nicht: Deutsche Männer waren wahlberechtigt, deutsche Frauen nicht. Punkt.
Nach diesem „Frankfurter Wahlgesetz“ sollte am 15. Juli 1849 das Volkshaus des Reichstags gewählt werden. Dazu kam es zwar nicht mehr, da die Revolution noch vor dem Wahltag niedergeschlagen wurde, allerdings diente das Frankfurter Wahlgesetz nach dem militärischen Sieg Preußens über Österreich 1866 als Muster für die Wahl zum konstituierenden sowie zum ersten ordentlichen Reichstag des Norddeutschen Bundes. Dieser Reichstag verabschiedete 1869 ein eigenes Bundeswahlgesetz, das sich im Wortlaut nur unwesentlich von seiner Vorlage unterschied:
„Wähler für den Reichstag des Norddeutschen Bundes ist jeder Norddeutsche, welcher das fünfundzwanzigste Lebensjahr zurückgelegt hat.“
Auch dieses Wahlgesetz kam nicht mehr zur Anwendung: Für den Sommer 1870 war zwar eine Wahl geplant, die jedoch aufgrund des Krieges gegen Frankreich verschoben wurde. Am 1. Januar 1871 wurde es für das Deutsche Reich übernommen und blieb ohne Veränderungen fast für die nächsten 50 Jahre in Kraft.
Die Revolution von 1848 stellte auch den Beginn einer sozialen und politischen Frauenbewegung dar. Vielerorts gründeten Frauen demokratische Vereine, politisierten sich und traten zunehmend für ihre eigenen Interessen ein. Frauenzeitungen wurden herausgegeben, die die „soziale Frage“ oder die „Arbeiterfrage“, die Auslöser der Revolution, in Hinsicht auf die Bürgerinnen und Arbeiterinnen diskutierten. Das Frauenwahlrecht spielte hier allerdings zunächst noch keine Rolle. So bemängelte zwar die sozialkritische Schriftstellerin Louise Otto (1819−1895) in der ersten Nummer der von ihr herausgegebenen »Frauen-Zeitung« vom April 1849: „Wo sie das Volk meinen, zählen die Frauen nicht mit.“ Als jedoch Hedwig Dohm (1831−1919) über 20 Jahre später in ihrem Essay »Der Jesuitismus im Hausstande« explizit das Stimmrecht für Frauen forderte, distanzierten sich Otto und der von ihr gegründete Allgemeine Deutsche Frauenverein; sie verstanden die „Frauenfrage“ vornehmlich als Bildungsfrage. Ähnlich sah das die Schriftstellerin Fanny Lewald (1811−1889), eine der Vorkämpferinnen der deutschen Frauenbewegung, die sich bereits zu Beginn der 1840er Jahre in ihren Erzählungen und Romanen für Gleichberechtigung ausgesprochen hatte: Zunächst sollten die Frauen das Recht auf gleiche Bildung sowie Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt bekommen, damit sie sich in einem nächsten Schritt – womöglich in ferner Zukunft − um das Wahlrecht verdient machen könnten. Ebenso hatte die Lehrerin Helene Lange (1848−1930), eine der wichtigsten Persönlichkeiten der bürgerlichen Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts, auf lange Sicht das Frauenwahlrecht durchaus vor Augen, auch ihr galten jedoch gleiche Bildungs- und Berufschancen für Frauen als die vorrangigen Ziele der Frauenbewegung.
Für Hedwig Dohm jedoch hatten es die Frauen nicht nötig, sich irgend etwas zu „verdienen“. Teilhabe am politischen Prozess war für sie ein Menschenrecht, und „Menschenrechte haben kein Geschlecht“. Das aktive und passive Wahlrecht sei Voraussetzung für jegliche weitere Gleichberechtigung.
Im Jahr 1896 gab sich das Kaiserreich nach langjährigen Beratungen ein Bürgerliches Gesetzbuch, die erste privatrechtliche Kodifikation, die für das gesamte Reichsgebiet Gültigkeit besaß. Auch wenn das BGB in weiten Teilen zuweilen durchaus fortschrittlich anmutete, folgte es in punkto Familienrecht weitgehend überkommenen patriarchalischen Traditionen:
㤠1354. Dem Manne steht die Entscheidung in allen das gemeinschaftliche eheliche Leben betreffenden Angelegenheiten zu; er bestimmt insbesondere Wohnort und Wohnung.
- 1363. Das Vermögen der Frau wird durch die Eheschließung der Verwaltung und Nutznießung des Mannes unterworfen (eingebrachtes Gut). Zum eingebrachten Gute gehört auch das Vermögen, das die Frau während der Ehe erwirbt.
- 1376. Ohne Zustimmung der Frau kann der Mann […] über Geld und andere verbrauchbare Sachen der Frau verfügen.
- 1395. Die Frau bedarf zur Verfügung über eingebrachtes Gut der Einwilligung des Mannes.“
Spätestens zu diesem Zeitpunkt war klar: Wenn die Frauen einfach darauf warteten, dass die Männer Gleichberechtigung und Frauenwahlrecht einführten, dann würden sie lange warten. Frau musste selbst aktiv werden, aktiver als bisher. Gleiche Rechte zu fordern alleine genügte nicht.
Die Frauen hatten bereits angefangen, zu mobilisieren, die SPD forderte im Erfurter Programm von 1891 „allgemeines, gleiches, direktes Wahl- und Stimmrecht […] ohne Unterschied des Geschlechts für alle Wahlen und Abstimmungen“. Nunmehr kam es zu einem regelrechten Gründungsboom von Frauenvereinen. Neben „gemäßigten“ Vereinen wie dem Allgemeinen Deutsche Frauenverein entstand eine „bürgerlich-radikale“ Frauenbewegung um Anita Augspurg (1857−1943), Lida Gustava Heymann (1868−1943) und Minna Cauer (1841−1922), sowie eine proletarische Frauenbewegung, die Gleichberechtigung mit Politik verband und deren zentrale Figur Clara Zetkin (1857–1933) war, die von 1892 bis 1923 die proletarisch-feministische Zeitschrift »Die Gleichheit« herausgab.
Augspurg, Cauer und Heymann gründeten 1902 den Deutschen Verein für Frauenstimmrecht; die zweite Internationale Frauenstimmrechtskonferenz wurde 1904 in Berlin abgehalten (die erste hatte 1902 in Washington stattgefunden), wo der Weltbund für Frauenstimmrecht gegründet wurde.
Beim Internationalen Sozialistenkongress, der im August 1907 in Stuttgart stattfand, wurde die Gründung der Sozialistischen Fraueninternationale beschlossen, auf deren zweiter Konferenz 1910 der Internationale Frauentag als „Kampftag“ für das Frauenwahlrecht festgelegt und der im folgenden Jahr erstmals begangen wurde.
Allerdings ergriff der nationale Taumel des Ersten Weltkrieges auch die Frauen, und die Zusammenarbeit mit den Frauen- und Stimmrechtsbewegungen anderer Länder kam ab 1914 weitgehend zum Erliegen. Gertrud Bäumer (1873−1954), die Vorsitzende des 1894 gegründeten Bundes Deutscher Frauenvereine initiierte bereits einige Tage nach Kriegsbeginn die Gründung einer nationalen Organisation, die alle Frauenvereine und karitativ wirkenden Initiativen und Einrichtungen zusammenführen sollte: Der Nationale Frauendienst organisierte die Kriegshilfearbeit der Frauen an der „Heimatfront“.
Immerhin solidarisierte man sich nun stärker untereinander; im Dezember 1917 reichten die deutschen Frauenstimmrechtsvereine eine erste gemeinsame »Erklärung zur Wahlrechtsfrage« beim Reichsparlament und allen Länderparlamenten ein, unterzeichnet von Minna Cauer, der SPD-Politikerin Marie Juchacz (1879−1956) und Marie Stritt (1855−1928), der Vorsitzenden des Deutschen Verbands für Frauenstimmrecht.
Nach Kriegsende lehnte kaum noch jemand ernsthaft das Frauenstimmrecht ab. Die Frauen hatten sich sowohl umfassend solidarisiert und organisiert als auch während des Kriegs „wertvolle“ Kriegsarbeit geleistet und dafür gesorgt, dass das wirtschaftliche Leben aufrecht erhalten werden konnte. Selbst die 1920 gegründete NSDAP mit ihrem extrem rückwärtsgewandten Frauenbild, die einzige Partei, die Frauen von Parteiämtern ausschloss, stellte sich dem aktiven Wahlrecht nicht entgegen. Und der Kieler Oberlehrer Ludwig Langemann vom Deutschen Bund zur Bekämpfung der Frauenemanzipation richtete seine aggressive Publikationstätigkeit nach der Auflösung der Organisation 1920 vermehrt gegen Juden und nicht mehr gegen Frauen.
Der Rat der Volksbeauftragten, die provisorische Regierung Deutschlands, beschloss, dass schnellstmöglich eine verfassungsgebende Nationalversammlung eingerichtet werden sollte, und setzte am 30. November 1918 die Wahl für den 19. Januar 1919 fest.
Der Wahlkampf war kurz aber hart und kräftezehrend, und die Zeit zwischen Kriegsende und der Wahl äußerst turbulent: Straßenschlachten, Plünderungen, Spartakus-Aufstand, Besetzung des Rheinlands, Ermordung Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts. Der 19. Januar selbst war hingegen von langen ruhigen Warteschlangen vor Wahllokalen geprägt und blieb auch ansonsten ruhig und somit „unspektakulär“. Selbst Frauen, die jahrzehntelang auf diesen Tag hin gekämpft hatten, übergehen ihn in ihren Erinnerungen. Nur besonders gewissenhafte Tagebuchschreiberinnen und -schreiber wie Käthe Kollwitz (1867−1945), Harry Graf Kessler (1868−1937), Thomas Mann (1875−1955), Viktor Klemperer (1881−1960) oder der Unternehmer und Kunsthistoriker Oskar Münsterberg (1865−1920) erwähnen ihn überhaupt. Niedergeschriebene Erinnerungen an den Wahlkampf, beispielsweise der Frauenrechtlerinnen Constanze Hallgarten (1881−1969) und Marie Bernays (1883−1939) oder der Schriftstellerin Ina Seidel (1885−1974), sind weitaus zahlreicher und ausführlicher.
Es wurden natürlich nicht „Männer“ und „Frauen“ in die Nationalversammlung gewählt, sondern politische Parteien, einige davon − die Deutsche Demokratische Partei, die Deutsche Volkspartei und die Deutschnationale Volkspartei − waren erst im November und Dezember 1918 gegründet worden. Die Frauen, die für die Nationalversammlung kandidierten, kandidierten also nicht in erster Linie als Repräsentantinnen der bis dahin vom politischen Leben ausgeschlossenen Hälfte der Bevölkerung, sondern als Vertreterinnen ihrer jeweiligen Parteien, beispielsweise Marianne Weber (1870−1954), Gertrud Bäumer und Minna Cauer für die DDP, Marie Bernays für die DVP, Marie Juchacz für die SPD, Lida Gustava Heymann für die USPD; oftmals allerdings nur auf den hinteren Listenplätzen, und so kam es, dass bei aller Euphorie und einer Wahlbeteiligung der Frauen von 82% der Frauenanteil im Nationalrat nur knapp 9% betrug. Das mag wenig erscheinen, aber angesichts der angeführten Gesetzestexte der Kaiserzeit und der haarsträubenden „Argumentationen“ der Antifeministen (siehe/höre Tracks 2 bis 5 auf diesem Hörbuch) war es ein Riesenerfolg. Und wohlgemerkt: Ein vergleichbarer Frauenanteil in einem deutschen Parlament wurde erst 1957 wieder erreicht − und das nächste Mal 1983… Mit der Wahl vom 19. Januar 1919 war der Kampf um das Frauenwahlrecht beendet; damit war ein Meilenstein für die Frauenbewegung in Deutschland gesetzt. Der Kampf um die Gleichberechtigung der Frau war damit natürlich keineswegs beendet, er ist es heute noch nicht, aber er war auf eine neue Ebene gehoben worden, auf die der Augenhöhe mit den Männern. Marie Juchacz formulierte die Zukunftsaussichten und -aufgaben in ihrer berühmten Rede vom 19. Februar 1919, der ersten Rede, die in einem deutschen Parlament von einer Frau gehalten wurde, folgendermaßen: „Zu all diesen Dingen, die wir uns vorstellen, hat die Umgestaltung unserer Staatsform zur Demokratie uns die Wege geöffnet. Jetzt heißt es, diese Wege zu beschreiten.“
Angela Kreuz studierte Psychologie in Konstanz; sie ist Schriftstellerin und arbeitet meistens an einem neuen Roman, einer Kurzgeschichte oder einem Gedicht. Sie ist viel auf Lesungen unterwegs, alleine oder zusammen mit anderen AutorInnen. In den letzten Jahren erschienen »Das surrealistische Büro. Kein Roman« (2018) sowie die Romane »Picknick an der Grenze« (2019) und »Taktwechsel« (2025).
2012 wurde sie für ihre vielfältigen literarischen Projekte mit dem Kulturförderpreis der Stadt Regensburg ausgezeichnet.
Dieter Lohr ist Literatur- und Medienwissenschaftler, Schriftsteller, Lehrer für Deutsch als Fremdsprache und seit der Gründung des LOhrBär-Verlags im Jahr 2004 auch Verleger und Hörspielregisseur.
Für die vorliegende Hörbuchanthologie hat er zusammen mit Angela Kreuz die Texte ausgewählt Allerdings ist »Frauen. Wahl. Recht.« nicht ihr erstes gemeinsames Hörbuchprojekt; ihr Feature »Der Fahrradspeichenfabrikkomplex« wurde 2010 für den Deutschen Hörbuchpreis nominiert.
Kira Bohn ist ausgebildete Schauspielerin und Sprecherin. Bereits während ihrer Studienzeit war sie u.a. am Theater Regensburg als Schauspielerin aktiv. Seit 2013 unterrichtet sie an der Akademie für Darstellende Kunst Bayern. Darüber hinaus ist sie als Unternehmungsberaterin und Trainerin tätig und bietet Workshops und Trainings in den Bereichen Stimme und Sprechen, Rhetorik und Performance an.
Im LOhrBär-Verlag war sie erstmals auf unserer Hörspielversion von Jaroslav Rudišs Roman »Grandhotel« zu hören.
Eva Sixt arbeitet freiberuflich als Schauspielerin, Sängerin und Autorin. Bekannt ist sie vor allem als Bairisch lernende Chinesin in Joseph Berlingers »Mei Fähr Lady« und als Chansonnette des Trio Trikolore.
Auf LOhrBär-Hörbüchern kann man sie als „Rumplhanni“ in Lena Christs gleichnamigem Roman hören, als „Ilja“ in Jaroslav Rudišs »Grandhotel« und auf unserer Böhmen-Anthologie. Für »Eine Zierde für den Verein« von Marieluise Fleißer hat sie darüber hinaus Konzeption und Textauswahl übernommen.
Gunna Wendt studierte Soziologie und Psychologie in Hannover und lebt seit 1981 als freie Schriftstellerin in München. Neben ihren Arbeiten für Theater und Rundfunk veröffentlichte sie Essays, Kurzgeschichten und zahlreiche Biografien, u.a. über Liesl Karlstadt, Paula Modersohn-Becker, Clara Rilke-Westhoff, Franziska zu Reventlow, Lena Christ, Maria Pawlowna, Maria Callas, Ruth Drexel.
Zuletzt erschien ihr Buch über Erika Mann und Therese Giehse, »Eine Liebe zwischen Kunst und Krieg«.
Martin Hofer wurde 1956 in Zürich geboren Nach Abschluss der Schauspielschule in Bern folgten Engagements in Basel, Göttingen, Ingolstadt, Erlangen und Regensburg. Seit 2009 leitet er das Regensburger Turmtheater.
Im LOhrBär-Verlag trat er erstmals auf Eva Demskis »Mama Donau« akustisch in Erscheinung; 2015 sprach er zusammen mit seinem – gleichfalls des schweizerischen Zungenschlags mächtigen – Schauspielerkollegen Heinz Müller Robert Walsers Roman »Der Gehülfe« ein.
Eva Demski arbeitete nach ihrem Studium als Dramaturgieassistentin, als freie Verlagslektorin und Übersetzerin und von 1969 bis 1977 beim Hessischen Rundfunk, vorwiegend für das Kulturmagazin »Titel, Thesen, Temperamente«. Sie ist aber auch die Erfinderin der legendären Pausenkatzen.
Seither lebt sie als freie Schriftstellerin in Frankfurt am Main. Zuletzt erschien 2017 ihr Erinnerungsband »Den Koffer trag ich selber«. Ihr Flussbuch »Mama Donau« wurde im LOhrBär-Verlag als Hörbuch produziert, gelesen von ihr selbst.
Christin Alexandrow ist Schauspielerin, Fotografin und Mentalcoach. Auf dem Bildschirm ist sie zu sehen in Serien wie den »Rosenheim Cops« oder »Soko Wismar«, ihre Leinwand-Premiere feierte sie als „Simone“ in der Verfilmung von Ingo Schulzes Roman »Adam und Evelyn« im September 2018 bei der „Settimana della Critica“ auf dem Filmfest Venedig.
Auf unserem LOhrBär Hörbuch »Grandhotel« von Jaroslav Rudiš kann man sie in der Rolle des Zimmermädchens „Zuzana“ hören.
Eva Ambrosius wurde 1971 im Schwäbischen geboren und lebt seit 1997 im Raum Regensburg. Hauptberuflich ist sie – mit Freude und Leidenschaft – Logopädin.
Weitere Berührungspunkte mit dem Thema „Stimme“ hatte und hat sie als Radiomoderatorin, als Sängerin in Duos und in Bands und nicht zuletzt auf unseren Hörbüchern »Scarlattis Wintergarten« von Angela Kreuz, dem BilderLeseHörbuch »Regensburger Wirtshausgeschichten« und zuletzt Jaroslav Rudišs »Grandhotel«.
Angelika Wende ist ausgebildete Sprecherin, Coach und Autorin. Sie war 13 Jahre lang Fernsehmoderatorin beim ZDF, davon zwei Jahre ZDF-heute-Nachrichtensprecherin.
Den Schwerpunkt ihrer Arbeit bildet seit Ende 2011 die Arbeit in ihrer Wiesbadener Praxis als Coach, Sprech- und Stimmtrainerin. Sie gibt Seminare zum Thema „Stimme, Sprache, Selbstwert und Selbstverwirklichung“. Als Autorin schreibt sie in ihrem Blog »Zwischen Innen und Außen« über die menschliche Psyche.
Sofia Mindel studierte in Weimar und Mainz Kulturwissenschaft und Journalismus. Anschließend war sie jahrelang für den Bayerischen Rundfunk als Radioreporterin in der Oberpfalz unterwegs, außerdem in der Online- und Nachrichtenredaktion tätig.
Heute arbeitet sie als Sprecherin. Zudem ist sie als Schauspielerin aktiv, seit 2008 regelmäßig beim Landestheater Oberpfalz. Zuletzt war sie 2018 in der Rolle der „Irene“ im Musical »Elternabend« von Thomas Zaufke und Peter Lund zu sehen und zu hören.
Monika Manz Urgestein der Münchner Theaterszene, hat sich viel in der Welt herumgetrieben, z.B. drei Jahre in New York am La Mama Theatre, hat einen Abschluss an der Münchner Kunstakademie, ein Chinesischstudium an der LMU, ist verheiratet mit dem Schauspieler Gerd Lohmeyer und seit der Geburt ihrer Tochter Luzie in München ansässig. Letzte Filmproduktionen: »Wackersdorf«, »München Mord«, »Matula – Der Schatten des Berges«, letztes Bühnensolo: »Muttersprache« von Werner Fritsch (je 2018).
Heike Ternes erhielt ihre Schauspielausbildung am Konservatorium der Stadt Wien. Schon während des Studiums war sie in Produktionen am Odeon Theater und dem Theater der Jugend in Wien zu sehen.
Ihr erstes festes Engagement führte sie ans Regensburger Stadttheater, es folgten Engagements u.a. an Bühnen in Bern, Trier, Erlangen, und Landshut. Seit 2008 arbeitet sie als Dozentin an der ADK Bayern. Daneben ist sie Regisseurin verschiedener Kindertheaterstücke, die sie am Akademietheater in Regensburg aufführt.
Michael Haake arbeitet nach Engagements am Theater Ingolstadt und Augsburg am Theater Regensburg. Als Sprecher hat er u.a. für den WDR und BR gearbeitet, hat in der Zeichentrickkinoproduktion »Der kleine tapfere Toaster« dem „Toaster“ seine Stimme geliehen und den „Daniel“ in der Produktion »Tischlein deck dich« der Augsburger Puppenkiste gesprochen.
Für den LOhrBär-Verlag wirkte er schon als „Scarlatti“ in der Vertonung von Angela Kreuz’ Roman »Scarlattis Wintergarten« mit.
Matthias Winter war schon während seiner Studienzeiten (Sprecherziehung, Sprechwissenschaft und Kulturmanagement) als Dozent an verschiedenen Schauspielschulen tätig. Von 2003 bis 2014 war er Intendant der Burgfestspiele Leuchtenberg und ab 2010 des Landestheaters Oberpfalz.
Auf unserer »Grandhotel«-Vertonung ist er als Protagonist „Fleischman“ und in Lena Christs Roman »Die Rumplhanni« als „Simmerl“ zu hören. Bei Bernhard Setzweins Hörspiel »3165 – Monolog eines Henkers« führte er Regie.
Kai Raecke ist seit 2010 als Sprecher tätig. So sammelte er erste Erfahrungen bei studentischen Theaterprojekten, den Yellow King Productions, dem NDR und in der TV-Werbung. 2017 gründete er den Youtube-Kanal »Ratisbona Liest« und sprach das „Bruckmandl“ für das VR-Projekt »Bruckmandl explores Neupfarrplatz« im historischen Museum Regensburg. Außerdem wirkte er bei unserem »Grandhotel«-Hörbuch mit.
Seit 2018 ist er beurkundeter Medienwissenschaftler und Sprecherzieher.
Ole Bosse ist ausgebildeter Schauspieler und Kunsttherapeut. Unter anderem spielte er am Stadttheater Regensburg. Weitere Engagements führten ihn ans Landestheater Niederbayern und ans Dehnberger Hoftheater. Darüber hinaus bietet er im Bereich der Kunsttherapie Theaterseminare an, sowie. zur Verbesserung des Eigenauftritts und des Stimmeinsatzes.
Für den LOhrBär-Verlag stand er erstmals als polternder Kneipenwirt auf unserem »Grandhotel«-Hörbuch vor dem Mikrofon.
Doris Dubiel war nach dem Schauspielstudium an verschiedenen Theatern engagiert, u.a. in Rostock, Erfurt, Stralsund, Greifswald und am Schleswig-Holsteinischen Landestheater, seit 2004 am Theater Regensburg. Bisher hat sie ca. 350 Rollen erarbeitet, nicht nur im Schauspiel sondern auch im Bereich Musical und Operette.
Sie wirkte in Fernsehproduktionen mit und arbeitete als Synchronsprecherin. Seit 2007 ist sie auch als Dozentin für Schauspiel an der Akademie für Darstellende Kunst Bayern tätig.
Bettina Schönenberg begann ihre Arbeit nach ihrer Schauspielausbildung als festes Ensemblemitglied am Theater Regensburg. Anschließend führten sie Gast-Engagements u.a. an die Komödie im Marquart Stuttgart, die Kammerspiele Landshut, das Altstadttheater Ingolstadt und das Prinzregenttheater Bochum.
Sie ist Dozentin für Theaterpädagogik an der ADK Bayern und hat neben ihrer Kapelle Die Diven und der Schmidt die künstlerische Leitung der Burghofspiele Falkenstein inne.
Gabriele Wahlbrink ist als Solistin oder in kleinen bis großen Besetzungen (Bigbands/Orchestern) als Leiterin, Instrumentalistin und Komponistin sowohl im „klassischen“ als auch im Jazz/Rock/Pop/Liedermacher/Chanson-Bereich unterwegs. Einige ihrer musikalischen Stationen sind und waren: Osnabrück, Hannover, Hamburg, Regensburg, Paris, Boston, New York.
Ihre Liebe zum Dialog von Literatur und Musik bringt sie u.a. auf zwei LOhrBär-Hörbüchern ein, zuletzt auf »Sommersprossen« mit Texten von Sigi Sommer.
„Das liebevoll und aufwendig gestaltete Hörbuch ist eine inspirierende und nachdenklich stimmende Collage - inklusive saxofonischer Denkpausen von Gabriele Wahlbrink.“
Kirsten Böttcher, Bayerischer Rundfunk
„Welchen Meilenstein das Frauenwahlrecht vor 100 Jahren markierte, lässt das Hörbuch mit seiner geglückten Auswahl lebendig werden.“
Kathrin Jütte, zeitzeichen
„Viele Zeugnisse, gut gelesen, spannend aufbereitet.“
Heribert Prantl, Süddeutsche Zeitung
„Die unterschiedlichen Stimmungen machen die durchwegs souveränen Sprecher/innen gut hörbar, mal kämpferisch, mal bissig, mal nachdenklich.“
Leonie Berger, SWR2
„weit über die einschlägige Literatur hinaus ein eindringliches akustisches Geschichtswerk.“
Christian Muggenthaler, Bayerische Staatszeitung
„[Das Hörbuch] lässt die historischen Ereignisse noch einmal lebendig werden.“
Bernhard Jugel, Bayerischer Rundfunk
„[Eine] wieder einmal ausgezeichnete silberne Scheibe aus dem Hause LOhrBär, […] innerhalb von 79 Minuten werden sich alle Nebel lichten.“
Florian Sendtner, lichtung
„Der Regensburger LOhrBär-Verlag versteht es, mit seinen besonderen Hörbüchern Themen aus der Tiefe der Historie ans Licht zu holen.“
Klaus Bovers, MUH
„[Ein] kleine[s], feine[s] Hörbuch, von dem man viel lernen kann.“
Bücher Magazin
„Ein weiterer, zu diesen Tagen passender Schatz aus dem famosen LOhrBär-Verlag.“
Literaturportal Bayern
„Mit tollen Stimmen wird der Hörerin, dem Hörer ein Panorama der Zeit präsentiert.“
Friederike Höhn, die Kirche
„Eine sehr gelungene CD.“
Irmgard Schroll-Decker, die Besprechung
„Das ist ein Hörbuch, das spricht für sich selbst. […] Sie müssen es einfach nur selbst hören.“
Shanghai Drenger, Radio Lotte, Radio Wartburg
„Ein Hörbuch lässt den Kampf ums Frauenwahlrecht lebendig werden.“
Rolf Löchel, literaturkritik.de