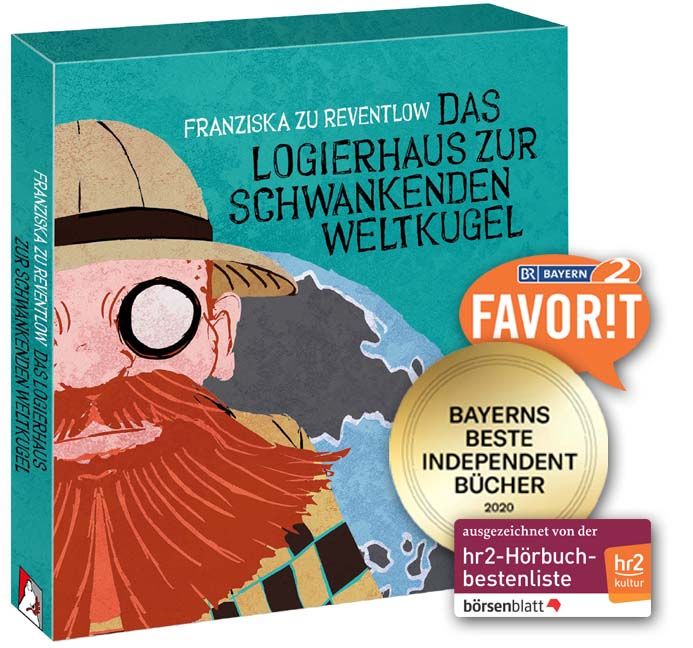
Franziska zu Reventlow
Das Logierhaus zur schwankenden Weltkugel
Lesungen
Sprecher:innen: Gunna Wendt, Michael Haake, Eva Sixt, Rüdiger Hacker, Matthias Winter, Kira Bohn, Bettina Schönenberg, Christin Alexandrow, Ole Bosse und Noah Alexander Wolf
Musik: Benedikt Dreher
1 USB-Stick / 1 mp3-CD, ca. 250 Minuten, 19,90 €
ISBN 978-3-939529-20-0
Hörprobe 1
Hörprobe 2
Hörprobe 3
Franziska zu Reventlow war eine der schillerndsten Figuren in der Münchner Bohème Ende des vorletzten, Anfang des letzten Jahrhunderts – eigenwillig, ausschweifendes Liebesleben, ständig in finanziellen Nöten. Und alleinerziehende Mutter. Ihre Romane sind überwiegend autobiographisch geprägt, daneben schrieb sie literarische Beiträge für Zeitschriften und Zeitungen wie den »Simplicissimus«, »Die Gesellschaft« oder die »Neue Deutsche Rundschau«.
Reventlows Kurzprosa zeichnet sich aus durch überschäumenden Ideenreichtum, einen herrlich surrealen Humor und eine Frische und Lockerheit im Ton, dass man zuweilen kaum glauben möchte, dass die Texte bereits über hundert Jahre alt sind. Dabei sind die Kurzgeschichten und Erzählungen meisterlich durchkomponiert und von hintergründiger Melancholie und Tiefgründigkeit.
Elf erzählerische Perlen. Zehn begeisterte Sprecherinnen und Sprecher und ein Fagottist, die die Texte so umsetzen, wie es – so meinen wir – auch der werten Frau Autorin selbst gefallen hätte.
 Fanny Liane Wilhelmine Sophie Auguste Adrienne Gräfin zu Reventlow war eine der schillerndsten Figuren in der Münchner Bohème Ende des vorletzten, Anfang des letzten Jahrhunderts. Sie galt als „Skandalgräfin“ und wurde als „heidnische Madonna“ oder „moderne Hetäre“ bezeichnet. Entsprechend sind in den letzten Jahren weitaus mehr Biographien und Beschreibungen ihres turbulenten Lebens erschienen als Neuauflagen ihrer Werke. Das ist schade, denn sie war, was über den zuweilen recht reißerischen Titeln fast in Vergessenheit gerät, auch Schriftstellerin, eine mindestens ebenso bemerkenswerte. Als herausragendes Gegenbeispiel sei an dieser Stelle »Franziska zu Reventlow. Die anmutige Rebellin« von Gunna Wendt nachdrücklich genannt; eine psychologisch fundierte Biographie.
Fanny Liane Wilhelmine Sophie Auguste Adrienne Gräfin zu Reventlow war eine der schillerndsten Figuren in der Münchner Bohème Ende des vorletzten, Anfang des letzten Jahrhunderts. Sie galt als „Skandalgräfin“ und wurde als „heidnische Madonna“ oder „moderne Hetäre“ bezeichnet. Entsprechend sind in den letzten Jahren weitaus mehr Biographien und Beschreibungen ihres turbulenten Lebens erschienen als Neuauflagen ihrer Werke. Das ist schade, denn sie war, was über den zuweilen recht reißerischen Titeln fast in Vergessenheit gerät, auch Schriftstellerin, eine mindestens ebenso bemerkenswerte. Als herausragendes Gegenbeispiel sei an dieser Stelle »Franziska zu Reventlow. Die anmutige Rebellin« von Gunna Wendt nachdrücklich genannt; eine psychologisch fundierte Biographie.
Daran, dass Franziska zu Reventlows literarisches Schaffen hinter ihrer Biographie ein wenig zurücksteht, hat sie selbst nicht unwesentlichen Anteil, da ihr Œuvre überwiegend autobiographisch gehalten ist. Überhaupt wollte sie eigentlich Malerin werden, das Schreiben hatte für sie zunächst eher therapeutischen Charakter. Über die Schreibversuche ihrer Jugendzeit äußerte sie später: „Weil ich nie jemand zum Anvertrauen hatte, habe ich, wenn es zu schlimm wurde, krampfhafte Versuche zum Gestalten meiner Gedanken gemacht und habe mich nie entschließen können, diese grausenerregenden Produktionen zu vernichten, weil sie ein Stück meines Lebens sind“. Über ihren ersten Roman »Ellen Olestjerne« (1903) schreibt sie, er sei „auch eine große innere Befreiung“. In dem Roman schildert sie ihre unglückliche Jugend, die strenge Erziehung in ihrer bis ins Mark preußischen Familie sowie in einem Mädchenpensionat, wo man sie allerdings nach nur einem Schuljahr wegen „nicht zu bändigender Widerspenstigkeit“ wieder ausschloss. 1893 überwarf sie sich mit ihrer Familie, verließ ihr Elternhaus und heiratete 1894 den Hamburger Juristen Walter Lübke, der ihr einen Aufenthalt in München finanzierte. Dort nahm sie Unterricht an der Malschule von Anton Ažbe, wo unter anderen Wassily Kandinsky und Alexej von Jawlensky ihre künstlerische Ausbildung absolvierten. Denn wie gesagt: Eigentlich wollte sie Malerin werden.
Die Ehe hielt nicht lange und wurde aufgrund „fortgesetzter Untreue“ 1897 geschieden. Die „fortgesetzte Untreue“ hatte es ihr angetan. Der Münchner Stadtteil Schwabing war im ausgehenden 19. Jahrhundert ein Treffpunkt der künstlerischen Bohème, Maler, Literaten, Musiker – meist ohne -innen. Franziska zu Reventlows Leben war eine große Party: lange Nächte, freie Liebe; teilweise wohnte sie mit zweien ihrer zahlreichen Liebhaber gleichzeitig in einer Wohnung.
Einerseits. Auf der anderen Seite war ihr Leben maßgeblich bestimmt von Geldmangel und einer fragilen Gesundheit. Sie erlitt mehrere Fehlgeburten, unterzog sich alle paar Jahre einer Operation, versuchte sich unter anderem als Versicherungsagentin, Sekretärin, Aushilfsköchin, Schauspielerin, als Aktmodell, sogar als Gelegenheitsprostituierte, um sich und ihren Sohn (* 1897) durchzubringen – alleinerziehende Mutter zu sein, ist heute noch kein Leichtes; wie mag es sich um die vorletzte Jahrhundertwende angefühlt haben? Darüber hinaus finanzierte sie ihr Leben mit literarischen Übersetzungen und kleineren schriftstellerischen Arbeiten für Zeitschriften und Tageszeitungen.
Und mit Geldleihen. 1910 floh sie vor ihren Gläubigern und einem drohenden Gefängnisaufenthalt zusammen mit ihrem Sohn in die Schweiz, nach Ascona am Lago Maggiore, wo sich seit 1900 allerlei illustre Künstler, Schriftsteller und Anhänger verschiedenster alternativer Lebensformen ansiedelten – Theosophen, Lebensreformer, Vegetarier, Naturheiler, Nudisten.
In den meisten der auf diesem Hörbuch versammelten Geschichten taucht früher oder später das Wort „Selbstmord“ auf; das Thema schien Franziska zu Reventlow stark umgetrieben zu haben. Ihr letzter Roman »Der Selbstmordverein« erschien ironischerweise erst posthum. Franziska zu Reventlow starb jung, mit nur 47 Jahren, allerdings nicht durch Suizid, sondern an den Folgen eines Fahrradunfalls im Sommer 1918.
»Das Logierhaus zur schwankenden Weltkugel und andere Novellen« (1917) ist ihr letztes zu Lebzeiten erschienenes Buch, es ist eine Sammlung der erwähnten literarischen Arbeiten für Zeitungen und Zeitschriften, die über einen Zeitraum von 20 Jahren erschienen sind. Auch diese Texte sind zuweilen stark autobiographisch geprägt und gespickt mit Verweisen auf Personen, Orte und Begebenheiten. Die Personenbeschreibungen in der Titelgeschichte beispielsweise sind dergestalt, dass die Münchner Zeitgenossen die – in der Regel überspitzt dargestellten – Personen durchaus erkannt haben dürften. »Wir Spione« verweist eindeutig auf den „Monte Verità“ am Lago Maggiore. Nur sollte man sich dadurch nicht hinreißen lassen, alles, was geschrieben steht, für bare Münze zu nehmen.
Paradebeispiel: die beiden Gerichte.
»Das Jüngste Gericht« erschien in der Nummer 41 des ersten Jahrgangs der satirischen Wochenzeitschrift »Simplicissimus« vom 9. Januar 1897. Hierin kommen Petrus und der liebe Gott überein, besagtes Gericht nicht ohne Hinzuziehung eines Staatsanwalts halten zu können, der natürlich im Folgenden einiges durcheinanderbringt. Ein realer Staatsanwalt erkannte sich wohl wieder, und gegen Franziska von Reventlow sowie den Verleger des »Simplicissimus« Albert Langen wurde Anklage wegen Gotteslästerung erhoben (einen Paragraphen zur Staatsanwaltslästerung gab es nicht), die gesamte Auflage des Hefts wurde konfisziert. Acht Nummern später, am 6. März, setzte Reventlow die Satire mit der Kurzgeschichte »Das allerjüngste Gericht« fort, in der sie die Gerichtsverhandlung um »Das Jüngste Gericht« ausführlich schildert, nicht mit Spott spart und etliche Personen des Münchner öffentlichen Lebens mit spitzer Feder an der Nase vorführt, vorrangig natürlich das Gerichtswesen. Und was ist an dieser Geschichte wahr? Schlicht und einfach: nichts. Alles komplett erfunden. Die konfiszierte Auflage des »Simplicissimus« war bereits nach wenigen Tagen wieder freigegeben, die Anklage fallengelassen worden.
Vorsicht also vor Autobiographischem von Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Ihr Geschäft ist die Fiktion. Und die Versuchung, etwas davon ins Autobiographische einfließen zu lassen, gar zu groß: Es findet sich immer jemand, der’s
glaubt. Was indes nicht bedeutet, dass die dergestalt fiktionalisierte Autobiographie nicht durchaus noch real werden könnte. Man nennt sie dann rückblickend „Prophezeiung“: Eindreiviertel Jahre später, im Oktober 1898, wurden gegen den Verleger Albert Langen, den Karikaturisten Thomas Theodor Heine und den Lyriker Frank Wedekind Haftbefehle wegen „Majestätsbeleidigung“ erlassen. Sie hatten Wilhelm II nach einer Pilgerfahrt des Kaiserpaares ins Heilige Land eine komplette Palästina-Nummer gewidmet, deren Ton wohl allzu großes Missfallen erregte: Alle drei wurden zu sechsmonatiger Festungshaft verurteilt, die Heine und Wedekind auf der Festung Königstein in Sachsen verbrachten. Langen konnte sich dem Zugriff der Polizei entziehen und verbrachte vier Jahre im Pariser Exil, ehe er nach einer Zahlung von 30.000 Mark nach Deutschland zurückkehren durfte.
Und schon haben die beiden Gerichte eine fast schon prophetische Aktualität. Neben den fortgesetzten Diskussionen darüber, was Satire darf und was nicht, wurde im Jahr 2016 unter dem Stichwort „Böhmermann-Affäre“ der Paragraph 103 des deutschen Strafgesetzbuchs noch einmal fulminant aus der juristischen Klamottenkiste gezogen. Man erinnert sich: Es ging um die das Vergehen „Beleidigung von Organen und Vertretern ausländischer Staaten“, einen Nachfolger des Paragraphen zur Majestätsbeleidigung.
Dass wir heute – mehr als 100 Jahre nach Ersterscheinen der Reventlow’schen Geschichten – nicht mehr alle Anspielungen und Seitenhiebe verstehen, liegt auf der Hand, tut aber der Qualität der Texte nicht den geringsten Abbruch; sie sind nach wie vor von spitzer Feder, sind brillant in ihren Handlungen, pfiffig aufgebaut, spannend erzählt und vom Sprachduktus her dergestalt unangestaubt, dass man mitunter an ihrem Alter zweifelt. Überhaupt fühlt man sich beim Hören der Texte zuweilen stark an die Gegenwart erinnert, sei es durch die beschriebenen Quarantäne-Maßnahmen bei Virus-Pandemien oder die Bart- und Anzugmode eines Hieronymus Edelmann.
Christin Alexandrow ist Schauspielerin, Fotografin und Mental-Coach und bezeichnet sich gern als Ideenmillionärin. Im Fernsehen spielte sie unter anderem für »Inga Lindström« und »Soko Leipzig«. Ihre Leinwand-Premiere feierte sie 2018 als „Simone“ in der Verfilmung von Ingo Schulzes Roman »Adam und Evelyn«. Und erst dieses Jahr hat sie ihr erstes eBook veröffentlicht.
Als Sprecherin im LOhrBär-Verlag hat sie auf Jaroslav Rudišs »Grandhotel« und un-serer Anthologie »Frauen. Wahl. Recht« mitgewirkt.
Kira Bohn ist ausgebildete Schauspielerin, Sprecherin und Sprecherzieherin. Sie studierte an der Universität Regensburg, aktuell promoviert sie in Halle. Bereits während ihrer Studienzeit war sie u.a. am Theater Regensburg als Schauspielerin aktiv. Seit 2013 unterrichtet sie an der Akademie für Darstellende Kunst Bayern. Darüber hinaus ist sie als Unternehmungsberaterin und Trainerin tätig und bietet Workshops und Trainings sowohl in den Bereichen Stimme und Sprechen als auch Rhetorik und Performance an.
Ole Bosse absolvierte eine Schauspiel- und Gesangsausbildung an der Akademie für Darstellende Kunst Bayern. Seitdem spielte und spielt er an diversen Theatern in Bayern. Unter anderem am Theater Regensburg, den Landestheatern Niederbayern und Oberpfalz sowie am Dehnberger Hoftheater.
Weiterhin gibt er kunsttherapeutische Theaterseminare. Seine Stimme leiht er dem LOhrBär-Verlag nun zum dritten Mal. Er ist unter anderem in den Filmen »Drudenherz«und »Wiebkes Weg« sowie zahlreichen Kurzfilmen zu sehen.
Benedikt Dreher ist als Fagottist und Blockflötist solistisch oder in Orchestern (z.B. dem Regensburger Kammerorchester), meist aber als Mitglied des Jazz-Folk-Trios Adabei, der Mittelalter-Folk-Rock-Band Zwielicht oder des Alte-Musik-Ensembles il legno scuro anzutreffen. Der studierte Musik-wissenschaftler (M.A.) unterrichtet an der Sing- und Musikschule Regensburg und ist Inhaber des Notenverlags Edition Molinari. Er arbeitete mit Künstlern wie Albrecht Mayer, Schandmaul, Donikkl, La Sfera oder Rolf Stemmle zusammen.
Michael Haake arbeitet nach Engagements am Theater Ingolstadt und Augsburg am Theater Regensburg. Als Sprecher hat er u.a. für den WDR und BR gearbeitet, hat in der Zeichentrick-Kinoproduktion »Der kleine tapfere Toaster« dem „Toaster“ seine Stimme geliehen und den „Daniel“ in der Produktion »Tischlein deck dich« der Augsburger Puppenkiste gesprochen.
Im LOhrBär-Verlag war er Titelheld in Angela Kreuz’ Erzählung »Scarlattis Wintergarten« und zuletzt auf unserem Frauenwahlrechts-Hörbuch zu hören.
Rüdiger Hacker findet „biografischen Scheiß“ langweilig. Statt dessen charakterisiert er sich folgendermaßen:
„Ich treibe mich seit fast 60 Jahren auf allen deutschsprachigen Bühnen herum (Burgtheater fehlt, also falls...) – als Schauspieler, Regisseur und jetzt auch noch als Autor. Sprecher auch für Hörbücher. Besonders schöne Aufgabe war: Sigi Sommer »Sommersprossen«, er-schienen im LOhrBär-Verlag. Noch gibt es CD’s, Zugreifen, sehr empfehlenswert!“
Tom Meilhammer studierte bei Professor Hans Seeger in München Illustration und Grafikdesign und arbeitet seit 1996 als freier Grafiker und Illustrator im Raum Regensburg vorwiegend mit regionalen Autorinnen, Autoren und Verlagen zusammen.
Er ist LOhrBär der ersten Stunde; seit 2005 hat er die meisten unserer Hörbuch-Cover und -Booklets gestaltet – stilistisch vielfältig und -seitig, aber immer am individuellen Strich wiederzuerkennen. Und nicht zuletzt stammt unser „Wappentier“, der LOhrBär, aus seiner Feder.
Bettina Schönenberg begann ihre Arbeit nach ihrer Schauspielausbildung als festes Ensemblemitglied am Theater Regensburg. Anschließend führten sie Gast-Engagements u.a. an die Komödie im Marquart Stuttgart, die Kammerspiele Landshut, das Altstadttheater Ingolstadt und das Prinzregenttheater Bochum.
Sie ist Dozentin für Theaterpädagogik an der ADK Bayern und hat neben ihrer Kapelle Die Diven und der Schmidt die künstlerische Leitung der Burghofspiele Falkenstein inne.
Eva Sixt arbeitet freiberuflich als Schauspielerin, Sängerin und Autorin. Bekannt ist sie vor allem als Bairisch lernende Chinesin in Joseph Berlingers Theaterstück »Mei Fähr Lady« und als Chansonnette des Trio Trikolore. In der Rolle der Rechtsmedizinerin Dr. Simkeit ist sie Teil der ZDF-E-folgsserie »Ein starkes Team«.
Als Sprecherin wirkt sie auf zahlreichen LOhrBär-Hörbüchern mit; für »Eine Zierde für den Verein« von Marieluise Fleißer hat sie darüber hinaus Konzeption und Textauswahl übernommen.
Gunna Wendt studierte Soziologie und Psychologie in Hannover und lebt seit 1981 als freie Schriftstellerin in München. Neben ihren Arbeiten für Theater und Rundfunk veröffentlichte sie Essays, Kurzgeschichten sowie zahlreiche Biografien, u.a. über Liesl Karlstadt, Paula Modersohn-Becker, Clara Rilke-Westhoff, Lena Christ, Maria Callas, Erika Mann und Therese Giehse. Zuletzt erschien ihr Buch »Henrik Ibsen und die Frauen«, in dem auch Franziska zu Reventlow als Mitglied der berühmt-berüchtigten Ibsen-Jugend vorkommt.
Matthias Winter war schon während seiner Studienzeiten (Sprecherziehung, Sprechwissenschaft und Kulturmanagement) als Dozent an verschiedenen Schauspielschulen tätig. Von 2003 bis 2014 war er Intendant der Burgfestspiele Leuchtenberg und ab 2010 des Landestheaters Oberpfalz.
Bei unserem Hörspiel »3165 – Monolog eines Henkers« nach Bernhard Setzweins gleichnamigen Theaterstück führte er Regie. Als Sprecher war er zuletzt auf unserer Anthologie »Frauen. Wahl. Recht.« zu hören.
Noah Alexander Wolf studiert Schauspiel an der Akademie für Darstellende Kunst Bayern und hat vorher in Berlin Philosophie und Politik studiert. Während seines Studiums hat er freiberuflich für die Friedrich-Ebert-Stiftung gearbeitet und war als Sprecher, Moderator und Filmschauspieler tätig. Er war Mitbegründer der Berliner Lesebühne »Schlesipoesie« und ist als Poetry-Slammer durch ganz Deutschland gereist. In »Das Logierhaus zur schwankenden Weltkugel« ist er das erste Mal auf einem LOhrBär-Hörbuch vertreten.
„Das ist ein ganz besonderes Hörvergnügen!“
Heribert Prantl, Süddeutsche Zeitung
„In den letzten Jahrzehnten las man eher vom Leben der Bohemienne und nicht das Werk der scharfzüngigen und wortgewandten Schriftstellerin. Wie schön, dass das jetzt anders ist.“
Jury der Hörbuchbestenliste des Hessischen Rundfunks und des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
„Ein liebevoll und einladend gestaltetes Hörbuch macht, hervorragend eingesprochen, die tiefsinnigen und melancholischen Texte der Autorin der Schwabinger Bohème von 100 Jahren zugänglich.“
Jury der Hotlist »Bayerns beste Independent Bücher«
„Vielseitiges Hörbuch mit melancholischen Zwischentönen.“
Christian Kosfeld, WDR 3
„Eine gelungene Hommage auf Franziska zu Reventlow, die durchaus dem heutigen Zeitgeist noch entspricht.“
Patricia Blob, Literaturportal Bayern
„Die vielstimmige Interpretation der Texte ist sehr abwechslungsreich und bietet einen unterhaltsamen Einblick in das, was man sich als Künstlerleben vorstellen mag: Reisende, Müßiggänger und Absinth trinkende Exzentriker bevölkern die Geschichten.“
Leonie Berger, SWR2
„Ein wunderbar bunter Einstieg in das autobiographisch geprägte Werk von Franziska zu Reventlow.“
Friedel Bott, BÜCHERmagazin
„Gerade ihre 'kleinen Sachen' sind richtig große Literatur. Die Sprecher/innen […] haben das verstanden, und man hört es ihnen an.“
Klaus Bovers, MUH
„Ein sehr, sehr großes Vergnügen zuzuhören. Es ist eine sehr schöne Entdeckung.“
Dorothee Meyer-Kahrweg, hr2
„Mit Spottlust nah an der Gegenwart.“
Antje Weber, Süddeutsche Zeitung
„Annette Kolb brachte es 1921 auf den Punkt, in jeder einzelnen Minute der 260 Minuten dieses wunderbaren Hörbuchs ist es zu hören: 'Ihr Zynismus kannte keine Grenzen, doch immer alles mit Grazie.'“
Florian Sendtner, lichtung
„Auch das musikalische 'Pausenzeichen', die Fagotteinlagen von Benedikt Dreher, greifen die unterschwellig melancholische Stimmung kunstvoll auf.“
Sabine Tischhöfer, Bayern im Buch
„Wie es sich für gute Geschichten gehört, eröffnet die Autorin schon in den ersten Sätzen eine ganze Welt, in der man sich dann für unterschiedlich lange Zeit aufhalten und dank der tadellosen Aufnahme prächtig amüsieren kann.“
Johannes Groß, lehrerbibliothek.de
„Fein- und hintersinnige Erzählungen und Dramolette.“
Florian Welle, Münchner Feuilleton
„Hier ist ein zauberhaftes kleines Kunstwerk zu entdecken.“
Marianne Sperb, Mittelbayerische Zeitung
„Großartige Geschichten, die keinen Moment langweilen …“
Frank-Michael Preuss, Redaktionsbüro für Bild & Text
„Höchst vergnüglich zu konsumierendes Hörbuch, das diverse gräfliche Texte zu einem 250-minütigen Hörgenuss versammelt.“
Christian Muggenthaler, Landshuter Zeitung
„Der Charme dieses Hörbuchs liegt vor allem in der liebevollen Gestaltung.“
Bernhard Jugel, Bayerischer Rundfunk
„Hinreißende Kurzgeschichten, vielseitig und -stimmig präsentiert von einem ausgewählten Sprecher*innen-Ensemble.“
Peter Eckhart Reichel, edition words & music
„Meisterlich durchkomponiert und von hintergründiger Melancholie und Tiefgründigkeit.“
Michael Brinkschulte, Hörspiegel
„„Eine Anarchistin der Tat, der in Regensburg immerhin ein schönes Denkmal gesetzt wurde, durch ein Hörbuch vom LOhrbär Verlag““
Paul Casimir Marcinkus, regensburg-digital
„„Elf Sprecherinnen und Sprecher machen mit Ausdruckskraft und Einfühlungsvermögen die Erzählungen mit ihren satirischen, ironischen und melancholischen Ausmalungen zu einem wahren Hörvergnügen!““
Hans Bergthaler, Freies Radio Freistadt